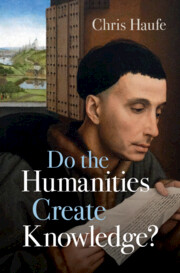Chris Haufe: Do the Humanities Create Knowledge?
Chris Haufe: Do the Humanities Create Knowledge?, Cambridge: Cambridge University Press, 2023, geb., XII+249 S., € 38,–, ISBN 978-1-316-51250-0
Seit dem 19. Jh. und z. T. bis heute findet ein Wissenschaftsverständnis weite Verbreitung, für das die Naturwissenschaften und ihre Methoden als Maßstab für Wissenschaftlichkeit gelten. Geisteswissenschaften kann nach dieser Auffassung nur dann der Titel „Wissenschaft“ zuerkannt werden, wenn sie sich an diesem Vorbild orientierten. Im englischen Sprachraum hat dies dazu geführt, dass nur die Naturwissenschaften als „sciences“ gelten, während die Wissenschaften, die sich mit den geistigen Hervorbringungen des Menschen befassen, als „humanities“ bezeichnet werden. Theologie arbeitet mit geisteswissenschaftlichen Methoden, die Diskussionen über die Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften können ihr daher nicht gleichgültig sein.
Chris Haufe, Professor of the Humanities and Chair of Philosophy an der Case Western Reserve University in Cleveland, ist davon überzeugt, dass es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen den „humanities“ und den „sciences“ gibt und dass auch die „humantities“ Wissen schaffen können. Er sieht allerdings ernsthafte Defizite in der heute üblichen Praxis der Geisteswissenschaften.
Seine Argumentation stützt sich u. a. auf Einsichten, die bereits Michael Polanyi (1958) und Thomas Kuhn (1962) formuliert haben, die aber bis heute nach Einschätzung Haufes nur unzureichend berücksichtigt werden. Stattdessen werde häufig eine Karikatur der wissenschaftlichen Methode propagiert: Man beobachte die Natur, formuliere dann eine Hypothese, aus der man eine Vorhersage ableite, die dann im Experiment bestätigt oder widerlegt werde. Die Wirklichkeit wissenschaftlicher Forschung sei aber sehr viel komplexer. Polanyi hatte betont, dass wir mehr wissen, als uns bewusst ist, ja dass wir manches von dem, was wir wissen, vielleicht gar nicht in Worte fassen können („tacit knowledge“). Kuhn hatte in der Geschichte der Naturwissenschaften beobachtet, dass Forscher in der „Normalwissenschaft“ innerhalb eines Paradigmas arbeiten, das viele unbewusste oder nicht reflektierte Überzeugungen, Motivationen und Verfahrensweisen enthält. Die notwendige Existenz eines solchen Rahmens von teilweise unbewussten Hintergrundannahmen und Praktiken führe dazu, so die These des vorliegenden Buches, dass „sciences“ und „humanities“ ähnlich arbeiten. „[B]oth domains participate in the general cultural form picked about by the term disciplinary inquiry“ (34).
“Disciplinary knowledge“ sei das Fachwissen einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin (Kap. 2). Dieses Wissen werde vor allem durch den weitgehenden Konsens der Gemeinschaft der Fachgelehrten hergestellt (Kap. 3). Der Konsens diene dazu, so etwas wie eine gemeinsame Sprache innerhalb der Disziplin herzustellen. Eine wichtige Rolle bei der Einführung neuer Adepten in eine Wissenschaft spielten „exemplars“. So werden Studierende der Naturwissenschaften nach wie vor anhand von Newtons Mechanik mit den Methoden der Physik vertraut gemacht, obwohl diese eigentlich „überholt“ sei. Eine ähnliche Rolle übernähmen in den Geisteswissenschaften kanonische Texte wie z. B. „Leviathan“ von Thomas Hobbes oder John Rawls „A Theory of Justice“. Nur wer tief in die Kultur der jeweiligen Fachdisziplin eingetaucht ist, erwerbe sich die erforderlichen (oft unbewussten) Kenntnisse, um fruchtbar an der Weiterentwicklung dieser Wissenschaft mitarbeiten zu können (Kap. 4). Dies führt in Kap. 5 zur zentralen These des Buches: „[K]nowledge of what matters manifests itself in the form of how things seem [to experts]“ (109). Diese zentrale Rolle der “scientific community” gilt für Natur- und Geisteswissenschaften. Der besondere Beitrag der letztgenannten bestehe darin, zu „knowledge of what matters to us“ zu führen. Dabei gehe es nicht nur darum, sozusagen empirisch festzustellen, was uns wertvoll ist, sondern um die Frage, was uns wertvoll sein sollte (Kap. 6).
Vor diesem Hintergrund übt Haufe Kritik am heutigen Zustand der „humanities“ (Kap. 7–9). Es werde zu wenig Wert gelegt auf die normative Rolle, die der Gemeinschaft der Fachgelehrten eigentlich zukomme. Jeder arbeite und forsche, wie es ihm oder ihr gut dünke, und anerkannte Gütekriterien für wissenschaftliche Arbeiten fehlten weitgehend. Damit korrespondiere die Tatsache, dass in mehreren aufsehenerregenden Fällen Aufsätze mit bewusst unsinnigem Inhalt trotz „peer review“ in geisteswissenschaftlichen Journalen publiziert wurden. Haufe plädiert für eine Rückkehr zur Strenge und intellektueller Ernsthaftigkeit, welche die „humanities“ über viele Jahrhunderte ausgezeichnet habe.
Haufe untermauert seine Argumente mit vielen überzeugenden Beispielen, die Lektüre des Buches ist gut geeignet zu einem vertieften Verständnis davon, wie Wissenschaft in der Geschichte gearbeitet hat und auch in Zukunft fruchtbar arbeiten kann. Seine These, dass Natur- und Geisteswissenschaften viele Gemeinsamkeiten haben und beide zu Wissen führen können, scheint mir gut begründet. Die Kritik an manchen Erscheinungen im Bereich der „humanities“ ist sehr gut nachvollziehbar, auch wenn manche Disziplinen wie z. B. die Geschichtswissenschaft m. E. von dieser Kritik nicht betroffen sind. Eine Rückkehr zu Strenge und intellektueller Ernsthaftigkeit in den Geisteswissenschaften (und auch in der Theologie) wäre zweifellos zu begrüßen. Unklar bleibt allerdings, wie Haufe sich einen solchen Umschwung vorstellt. Sollte es wirklich genügen, dass die „scientific community“ der einzelnen Fachdisziplinen sich auf das Ideal einer gemeinsamen Kultur besinnt und dann wie von selbst wieder zu einer gemeinsamen Kultur findet? Wahrscheinlich ist es zu viel verlangt, von Haufe eine Antwort auf diese Frage zu erwarten, er sieht seinen Beitrag vermutlich darin, hier überhaupt einen Denkprozess in Gang zu setzen. Aber ist nicht ein wesentlicher Teil des Problems, dass es in etlichen Fachdisziplinen gerade kein allgemein anerkanntes Paradigma mehr gibt, an dem sich alle orientieren könnten? Es dürfte ja wohl nicht nur Gedankenlosigkeit sein, dass es zahllose intellektuelle Subkulturen in den „humanities“ und auch etliche „Theologien“ gibt, die weitgehend in ihrer eigenen Welt leben und kaum Bezug aufeinander nehmen. Was ist zu tun, wenn – wie es ja tatsächlich der Fall ist – verschiedene Paradigmen innerhalb einer Wissenschaft miteinander konkurrieren? Hier müsste m. E. eine argumentative Auseinandersetzung mit den (zunächst bewusst zu formulierenden) Denkvoraussetzungen der einzelnen Paradigmen stattfinden. Und solange diese Auseinandersetzung nicht zu einem weitgehenden Konsens geführt hat, sollten, wie schon Paul Feyerabend (1976) vorgeschlagen hat, die verschiedenen Forschungsgemeinschaften innerhalb ihrer jeweiligen Paradigmen arbeiten. In einem solchen Rahmen wäre auch eine Rückkehr zu Strenge und intellektueller Ernsthaftigkeit möglich.
Dr. Ralf-Thomas Klein, Lehrbeauftragter für Wissenschaftstheorie und Lateinische Quellentexte an der FTH Gießen